Prüfungsfragen für gewerbsmäßige Tandem-Piloten
Dieser aktualisierte Blogbeitrag enthält das gesamte Prüfungswissen für Gleitschirm-Tandempiloten in Deutschland und Österreich.
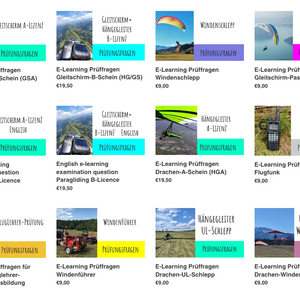
Prüfungsfragen für gewerbliche Gleitschirm-Tandempiloten
(Gültig für Deutschland und Österreich)
1. Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen
1.1. Genehmigungspflicht und Tauglichkeit
In Deutschland unterliegen gewerbsmäßige Passagierflüge keiner berufsrechtlichen Genehmigungspflicht, ebenso wenig wie in Österreich[cite: 1]. Während gewerbliche Tandempiloten in Deutschland kein fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis (Medical) benötigen, ist es in Österreich Voraussetzung[cite: 2].
1.2. Flüge mit Minderjährigen
Soll ein Minderjähriger mitfliegen, so bedarf es regelmäßig der schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten[cite: 3].
1.3. Lizenzentzug
Sollte ein Pilot das praktische Können oder fachliche Wissen zum sicheren Durchführen von Passagierflügen nicht (mehr) besitzen, so kann die zuständige Stelle die Lizenz und Passagierberechtigung widerrufen[cite: 4].
1.4. Spezifische Anforderungen in Österreich für gewerbliche Flüge
In Österreich muss ein Pilot die Doppelsitzer-Berechtigung mindestens zwölf Monate besitzen und mindestens 100 Doppelsitzer Höhen-Flüge mit Scheininhabern durchgeführt haben, davon 25 in den letzten zwölf Monaten, bevor er gewerblich fliegen darf[cite: 5].
1.5. Regelungen im Ausland
Bei Tandemflügen im Ausland gelten stets die Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes[cite: 19].
2. Haftung und Versicherungen
2.1. Haftungsgrundlagen und Beförderungsvertrag
Nach deutschem Recht kann die Haftung des Piloten auf Grundlage eines Beförderungsvertrages generell nicht ausgeschlossen werden[cite: 7]. Ein solcher Vertrag kommt regelmäßig dann zustande, wenn die im Folgenden genannten Punkte vorliegen; dann gelten die Haftungsbestimmungen des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG)[cite: 8]. Ein Beförderungsvertrag wird regelmäßig dann unterstellt, wenn der Passagier für den Flug bezahlt, unabhängig davon, ob das schriftlich vereinbart wurde oder nicht[cite: 54]. Selbst Gegenleistungen wie eine „Einladung ins Restaurant“ oder die „Bezahlung der Bergfahrt“ gelten als Begründung für einen Beförderungsvertrag[cite: 55]. Besteht ein Beförderungsvertrag, haftet der Pilot nach deutschem Luftrecht auch dann, wenn ein Schaden des Passagiers (durch Unfall) ohne Verschulden des Piloten eintritt[cite: 56]. Sobald ein Beförderungsvertrag zustande gekommen ist, ist jeglicher Haftungsausschluss stets unwirksam (Unabdingbarkeit)[cite: 34].
2.2. Haftung bei grober Fahrlässigkeit
Verursacht ein Pilot grobfahrlässig einen Unfall, so haftet dieser stets in unbegrenzter Höhe[cite: 10, 36].
2.3. Haftung als Luftfrachtführer
Führt ein Tandempilot als sogenannter Luftfrachtführer im Auftrag eines gewerblichen Unternehmens (das wiederum Halter der Flugausrüstung und vertraglicher Luftfahrtfrachtführer ist) einen Passagierflug durch, so haften im Falle eines Unfalls sowohl der Pilot als auch der Auftraggeber[cite: 11].
2.4. Passagierhaftpflichtversicherung
Für unentgeltliche Gefälligkeitsflüge ist in Deutschland eine Passagierhaftpflichtversicherung nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber dringend empfohlen[cite: 9]. In Deutschland sind für Passagierflüge sowohl eine Passagierhaftpflichtversicherung als auch eine Halterhaftpflichtversicherung vorgeschrieben[cite: 29]. Erstere muss aber eine Mindestversicherungssumme von 250.000 Rechnungseinheiten aufweisen[cite: 30].
2.5. Unterscheidung im deutschen Luftrecht
Hinsichtlich der Haftungsbestimmungen unterscheidet das deutsche Luftrecht zwischen Flügen mit und ohne Beförderungsvertrag[cite: 30]. Auch bei unentgeltlichen Flügen ist ein Haftungsausschluss regelmäßig dann unwirksam, wenn die Flüge im Zusammenhang mit Beruf oder Gewerbe des Piloten stehen[cite: 31].
2.6. Unterscheidung im österreichischen Luftrecht
Das österreichische Luftrecht unterscheidet dagegen zwischen privaten und gewerblichen Flügen[cite: 32]. Hier sind für alle Passagierflüge eine Passagierhaftpflichtversicherung sowie eine Halterhaftpflichtversicherung vorgeschrieben, auch für private Flüge[cite: 33].
2.7. Beweispflicht und Haftungssummen
Bei Personen- oder Sachschaden des Passagiers liegt bei einem gewerblichen Passagierflug die Beweispflicht darüber, dass der Unfall nicht zu verhindern gewesen sei, stets beim Piloten[cite: 26]. Nur bei erwiesener Schuldlosigkeit des Piloten und Vorliegen eines Beförderungsvertrages ist die Haftungssumme auf höchstens 113.100 Rechnungseinheiten begrenzt[cite: 27]. Der Pilot haftet also in jedem Fall[cite: 28]. Ein Pilot haftet bei Verschulden stets unbegrenzt, ohne Verschulden mit bis zu 113.100 Rechnungseinheiten[cite: 35].
2.8. Rechnungseinheiten (Sonderziehungsrechte - SZR)
Die Berechnung der "Rechnungseinheiten" gemäß der Luftverkehrsverordnung (LuftV) im Schadenfall basiert auf den Regelungen des Montrealer Übereinkommens (MÜ) und der darin festgelegten Haftungsgrenzen[cite: 36]. Die Rechnungseinheit, die dabei verwendet wird, ist das sogenannte Sonderziehungsrecht (SZR), eine künstliche Währungseinheit, die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) definiert wird[cite: 37].
2.8.1. Definition SZR
Das Sonderziehungsrecht (SZR) ist eine internationale Reservewährung, deren Wert sich aus einem Währungskorb zusammensetzt[cite: 38]. Dieser Korb umfasst derzeit die Währungen: US-Dollar (USD), Euro (EUR), Chinesischer Yuan (CNY), Japanischer Yen (JPY) und Britisches Pfund (GBP)[cite: 39, 40]. Der Wert eines SZR wird täglich vom IWF auf Basis der Wechselkurse dieser Währungen berechnet[cite: 40].
2.8.2. Berechnung der Haftung in Rechnungseinheiten
Die Haftung im Schadenfall wird in SZR angegeben[cite: 41]. Um den tatsächlichen Betrag in einer Landeswährung (z. B. Euro) zu berechnen, wird der aktuelle Umrechnungskurs des SZR herangezogen[cite: 42]. Dieser Kurs wird regelmäßig vom IWF veröffentlicht[cite: 43].
- Beispiel: Angenommen, die Haftungsgrenze beträgt 100.000 SZR (z. B. bei Personenschäden im Luftverkehr)[cite: 43]. Der aktuelle Umrechnungskurs des SZR in Euro beträgt 1 SZR = 1,25 EUR[cite: 44]. Die Haftungssumme in Euro beträgt dann: 100.000 SZR * 1,25 EUR/SZR = 125.000 EUR[cite: 45].
2.8.3. Anwendung im Schadenfall
Die Luftverkehrsverordnung (LuftV) verweist auf die Haftungsgrenzen des Montrealer Übereinkommens, die in SZR festgelegt sind[cite: 46]. Diese Haftungsgrenzen gelten für:
- Personenschäden: Die Haftung ist bis zu einem bestimmten Betrag (z. B. 128.821 SZR, Stand 2023) verschuldensunabhängig[cite: 47]. Darüber hinaus haftet der Luftfrachtführer nur bei Nachweis von Verschulden[cite: 48].
- Gepäckschäden: Haftung bis zu 1.288 SZR pro Passagier[cite: 48].
- Fracht- und Güterschäden: Haftung bis zu 22 SZR pro Kilogramm[cite: 49].
- Verspätungsschäden: Haftung bis zu 5.346 SZR pro Passagier[cite: 50].
2.8.4. Aktueller Umrechnungskurs
Der aktuelle Umrechnungskurs des SZR kann auf der Website des IWF oder bei der Deutschen Bundesbank eingesehen werden[cite: 50]. Dieser Kurs schwankt täglich, da er von den Wechselkursen der zugrunde liegenden Währungen abhängt[cite: 51].
2.8.5. Zusammenfassung der Berechnung
- Haftungsgrenzen sind in SZR festgelegt[cite: 52].
- Der Wert eines SZR wird täglich vom IWF veröffentlicht[cite: 52].
- Zur Berechnung der Haftung in Euro wird der aktuelle SZR-Kurs mit der Anzahl der SZR multipliziert[cite: 53].
3. Lizenzierung und Berechtigungen
3.1. Mitführpflichten
Tandempiloten in Österreich und Deutschland müssen folgende Nachweise mitführen: Fluglizenz, Versicherungsnachweis, Personalausweis[cite: 20].
3.2. Erhaltung der Passagierberechtigung
Zur Erhaltung der Passagierberechtigung muss ein Pilot die erforderliche Flugerfahrung nach §45a LuftPersV besitzen[cite: 22]. Dazu bedarf es mindestens dreier Starts und Landungen innerhalb der letzten 90 Tage mit einem ein- oder doppelsitzigen Gleitschirm[cite: 23]. Die Passagierberechtigung verliert ihre Gültigkeit 36 Monate nach deren Erteilung, wenn vorher kein Checkflug durchgeführt worden ist[cite: 59].
3.3. Regelungen für Erteilung und Erneuerung
Die Regelungen für die Erteilung, den Umfang, die Gültigkeitsdauer und Erneuerung der Passagierflugberechtigung sind für Deutschland in der LuftPersV und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des DHV festgelegt[cite: 62]. In Österreich ist dies in der Zivilluftfahrt-Personalverordnung (ZLPV) festgelegt[cite: 63]. Die Verlängerung der Passagierberechtigung in Deutschland und Österreich erfolgt durch die Bestätigung eines doppelsitzigen Checkfluges durch eine Flugschule im Flugbuch des Piloten[cite: 63]. Verpasst der Pilot diese Frist, so ist er verpflichtet, eine Nachschulung in einer Flugschule zu absolvieren, die im Flugbuch bestätigt werden muss[cite: 64].
3.4. Spezifische Lizenzen und Berechtigungen
Nur wenn ein Pilot auch die deutsche B-Lizenz mit Überlandberechtigung innehat, darf er Überflüge mit dem Doppelsitzer durchführen, wenn er die Passagierberechtigung besitzt[cite: 57]. Mit einer A-Lizenz wäre das nicht erlaubt; er dürfte lediglich lokale Flüge durchführen[cite: 58].
Für den Windenschlepp für Passagierflüge müssen deutsche Lizenzinhaber durch eine berechtigte Flugschule einen zusätzlichen Nachweis erbringen[cite: 60]. Eine mit Solo-Gleitschirm erlangte Windenstartberechtigung reicht nicht aus[cite: 61].
4. Ausrüstung und Sicherheit
4.1. Gleitschirm und Klassifizierung
Schnelle Tandem-Schirme der LTF-Klassen C & D dürfen nach deutschen Vorschriften nur mit Passagieren geflogen werden, die selbst einen Luftfahrerschein für Gleitschirme besitzen[cite: 6]. Doppelsitzer-Flüge mit Einsitzer-Fluggeräten sind stets verboten[cite: 65]. Es bedarf dazu stets sogenannter zugelassener Tandem-Gleitschirme innerhalb des zugelassenen Gewichtsbereiches[cite: 65]. Es gibt auch Gleitschirme, die sowohl als Tandem als auch als Soloschirm zugelassen sind[cite: 153]. Verwendet man so einen Gleitschirm im Tandembetrieb, so verlagert sich die Aufhängung nach unten, weshalb die Bremsen verlängert werden müssen[cite: 154]. Sonst hat der Pilot das Problem, dass er kaum an die Bremsen herankommt oder dass diese während des Fluges zu stark gezogen werden[cite: 155].
4.2. Gurtzeuge und Rückenschutz
Beim Passagierfliegen müssen die Gurtzeuge von Pilot und Passagier mit einem mustergeprüften Rückenschutz ausgestattet sein[cite: 70]. Insbesondere für kleine Menschen bedarf es eines gesonderten Gurtzeuges, das für die entsprechende Körpergröße sicheren Halt, sowohl seitlich als auch unterhalb des Brustgurtes garantiert[cite: 102]. Ist die Sitzfläche zu breit für einen Passagier, so hat dieser keinen festen Halt und kann möglicherweise im Flug Angst bekommen[cite: 103]. Deswegen sollte ein Passagier-Gurtzeug weder zu groß noch zu klein sein[cite: 104]. Die Schultergurte und Beingurte sollten so eingestellt sein, dass Sitzbrett und Protektor bis unter das Gesäß des Passagiers reichen[cite: 112].
4.3. Rettungsgerät
Die Aufhängung des Tandem-Rettungsgerätes erfolgt ausschließlich in der Hauptaufhängung an der T-Bar[cite: 71]. Diese ist wie eine T-förmige Waage, an welcher der Passagier vorne und der Pilot hinten, sowie die Traggurte des Schirms in der Mitte eingehängt sind[cite: 72]. Das deutsche Synonym ist "Tandemspreize", denn sie sorgt für einen angenehmen Abstand zwischen den beiden[cite: 73, 74]. Dabei muss die maximale Anhängelast des Tandem-Rettungsgerätes mindestens so hoch sein wie das Startgewicht[cite: 74]. Das Rettungsgerät darf ausschließlich im Außencontainer des Pilotengurtzeuges montiert werden, keinesfalls jedoch in einem Frontcontainer[cite: 75]. Keinesfalls darf das Rettungsgerät an der Verbindungsleine des Pilotengurtzeuges befestigt sein, weil der Passagier sonst nach der Rettungsschirmauslösung deutlich unter dem Piloten hinge[cite: 76]. Dies könnte zu schwersten Verletzungen bei der Landung führen[cite: 77].
4.4. T-Bar (Tandemspreize)
Die Position, an der ein Passagier bei einem Tandem-Gleitschirm an der sogenannten T-Bar eingehängt wird (oben oder unten), hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Größe und dem Gewicht des Passagiers sowie von der gewünschten Balance und Steuerbarkeit des Schirms[cite: 125]. Grundsätzlich sollte der Passagier, nach Möglichkeit, zuerst abheben[cite: 126].
Wichtige Überlegungen zur Einhängeposition des Passagiers an der T-Bar:
- Gewichtsverteilung und Balance:
- Ein schwererer Passagier wird in der Regel unten eingehängt, um eine bessere Balance zu gewährleisten, da das Gewicht näher am Schwerpunkt des Systems liegt[cite: 126, 127, 136, 137]. Dadurch bleibt der Schirm stabiler und leichter zu steuern[cite: 128, 138].
- Ein leichterer Passagier kann oben eingehängt werden, da dies die Balance weniger beeinflusst und der Pilot mehr Kontrolle über den Schirm behält[cite: 129, 139].
- Größe des Passagiers:
- Ein größerer Passagier wird oft unten eingehängt, da dies die Sitzposition angenehmer macht und verhindert, dass der Passagier den Piloten behindert (z.B. durch Kopf oder Schultern)[cite: 130, 140].
- Ein kleinerer Passagier kann oben eingehängt werden, da er weniger Platz einnimmt und die Sicht sowie Bewegungsfreiheit des Piloten nicht einschränkt[cite: 131, 141].
- Komfort und Sicht:
- Die Position sollte so gewählt werden, dass sowohl der Pilot als auch der Passagier eine angenehme Sitzposition haben und der Pilot eine gute Sicht nach vorne behält[cite: 132, 142]. Ein zu hoch eingehängter großer Passagier könnte die Sicht des Piloten behindern[cite: 133, 143].
- Steuerbarkeit des Schirms:
- Die Steuerbarkeit des Schirms hängt stark von der Gewichtsverteilung ab[cite: 134, 144]. Ein schwerer Passagier oben könnte den Schirm instabil machen oder die Steuerung erschweren, während ein leichter Passagier unten möglicherweise weniger Einfluss auf die Balance hat[cite: 135, 145].
4.5. Festigkeitsvorschriften und Materialwartung
Wie in der Luftfahrt üblich, müssen die Festigkeitsvorschriften hohen Ansprüchen genügen[cite: 156]. So muss die Hauptaufhängung das Neunfache des maximalen Startgewichts tragen können[cite: 157]. Die Mindestbruchlast eines Tandemschirms liegt bei 11.000 N[cite: 158]. Die Verbindungselemente zwischen Rettungsgerät und Hauptaufhängung müssen mindestens 24.000 N aushalten[cite: 158]. Bei Verbindungselementen aus Aluminium müssen diese ausgetauscht werden, sobald Dellen oder Kerben sichtbar sind, der Schnapper nicht mehr selbstständig schließt oder die vom Hersteller angegebene Gebrauchsdauer überschritten worden ist[cite: 105]. Verwendet man für die Rettungsgeräteaufhängung Schraub-Karabiner oder Schraubglieder (Maillon Rapid), so sind diese in kurzen Zeitabständen auf den festen Sitz der Verschraubung zu kontrollieren[cite: 106].
4.6. Informationspflicht und Nachprüfung
Pilot und/oder Halter sind verpflichtet, sich regelmäßig über mögliche Sicherheitsmitteilungen zu informieren und müssen diese verbindlich beachten[cite: 66]. Dazu gehört das regelmäßige Einholen von Informationen darüber, ob ein Fluggerät von einer Lufttüchtigkeitsanweisung, Sicherheitsmitteilung oder angeordneten Nachprüfung betroffen ist[cite: 67]. Die Nachprüfung (Check) eines doppelsitzigen Gleitschirms muss in den Zeitabständen erfolgen, die der Hersteller in der Betriebsanleitung des Geräts angibt[cite: 68]. Sollten die oben genannten Punkte nicht beachtet werden, so riskiert der Pilot den Versicherungsschutz, macht sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig und kann mit einem Bußgeld bestraft werden[cite: 69]. Getestet werden die Gleitschirme sowohl mit minimalem als auch mit maximalem Startgewicht, sodass gutmütige Flugeigenschaften garantiert werden können[cite: 159].
5. Flugvorbereitung
5.1. Allgemeine Pflichten
Im Rahmen der Flugvorbereitung ist jeder Pilot verpflichtet, sich mit den zur Verfügung stehenden Luftfahrtinformationen vertraut zu machen, die neuesten Wettermeldungen und Wettervorhersagen zu studieren, sowie Ausweichmaßnahmen für den Fall zu planen, dass ein Flug nicht in vorhergesehener Weise zu Ende geführt werden kann[cite: 21].
5.2. Vorflugcheck
Im Rahmen des Vorflugchecks ist es besonders wichtig, den Rettungsgeräte-Container auf den ordnungsgemäßen Verschluss zu überprüfen[cite: 122]. Der Griff für das Rettungsgerät muss vorschriftsmäßig eingefädelt und gesichert sein[cite: 123]. Außerdem checkt der Pilot noch einmal alle Verschlüsse an den Gurtzeugen und ob der Gleitschirm korrekt an der T-Bar (diese muss auch den Lufttüchtigkeitsanforderungen (LTF) entsprechen) eingeklinkt ist[cite: 124]. Dann kontrolliert der Pilot auch die korrekte Einstellung der Trimmer[cite: 146]. Sie dienen dazu, die Fluggeschwindigkeit zu steuern und müssen symmetrisch fixiert sein[cite: 147]. Zudem wirft er noch einen Blick auf die freien Leinen, die Eintrittskante, den Luftraum und auf den Windsack[cite: 148]. Erst dann macht er einen Kontrollblick, bevor er einen Start in Erwägung zieht[cite: 149]. Sollte, kurz vor dem Start, durch eine Windböe die Eintrittskante des ausgelegten Schirmes umfallen und Helfer legen diese wieder ordentlich aus, sollte auf jeden Fall der Startcheck erneut durchgeführt werden: Leinen, Eintrittskante, Wind und Luftraum[cite: 183].
5.3. Passagierbriefing und -vorbereitung
Der Pilot sollte vorab den Startablauf kurz und präzise, inklusive Benennung der Kommandos, beschreiben[cite: 110]. Vor dem Start sollten mit dem Passagier Trockenübungen, nämlich das Üben des Startlaufs und eine Sitzprobe im Gurtzeug vorgenommen werden[cite: 111]. Der Startlauf sollte mit angelegtem Gurt und Helm erfolgen, wobei der Pilot dabei die vorher vereinbarten Kommandos benutzt (z.B. "3-2-1 lauf!")[cite: 114]. Es hat sich bewährt, wenn man als Pilot seitlich versetzt zum Passagier läuft, weil dadurch ein behinderungsfreier Startlauf möglich wird[cite: 115].
Ist ein Passagier besonders nervös, so sollte man ihm Zeit lassen und erst mal Vertrauen schaffen, indem man ruhige Erklärungen abgibt[cite: 108]. Zudem kann man den Passagier in die Startvorbereitungen mit einbeziehen und den Startlauf nochmals üben[cite: 109].
Wenn ein Passagier auf die Frage „Bist du bereit?“ vor dem Aufziehen die Antwort „Nein, ich traue mich nicht!“ gibt, sollte man die Ängste ernst nehmen, betont ruhig auftreten und noch einmal das Wichtigste erklären[cite: 116, 117, 118]. Am besten muntert man den Passagier auf, indem man ihm von den wunderbaren Perspektiven erzählt, die er im Flug gleich erleben wird[cite: 119]. Dann schlägt man nach einiger Zeit erneut den Start vor[cite: 120].
6. Start
6.1. Startplatzanforderungen
Ein sicherer Startplatz muss frei von Hindernissen sein, sollte einen Startabbruch ermöglichen und auch seitlich genügend Platz bieten, um schräg aufziehen zu können[cite: 80]. Der optimale Startplatz hat circa 10° Neigung und einen homogenen Übergang in steiles Gelände von circa 20-25°[cite: 150]. Startplätze mit Geländekanten oder Klippenstarts bergen die Gefahr, dass der Passagier sich zu früh ins Gurtzeug setzt, was einen Startabbruch notwendig machen kann (aber nicht muss)[cite: 81].
6.2. Einflussfaktoren auf die Startstrecke
Die Länge der Startstrecke wird durch das Startgewicht, Gegenwind und Laufgeschwindigkeit, die Schirmfläche sowie die Startplatzhöhe (dünnere Luft) beeinflusst[cite: 78]. Startet ein Tandempilot mit dem maximalen Startgewicht, verlängert sich die Startstrecke deutlich[cite: 79].
6.3. Startlauf
Für mehr Sicherheit sorgt es, wenn der Passagier zunächst mit normalen Schritten langsam Zug nach vorne ausübt und dann mit immer größeren Schritten kontinuierlich beschleunigt[cite: 83]. Der Passagier hat dabei seine Arme vor der T-Bar und damit eine mäßige Körpervorlage[cite: 84]. Die gefährlichste Phase des Startlaufes ist dann, wenn die Laufgeschwindigkeit bereits hoch, die Abhebegeschwindigkeit aber noch nicht erreicht ist[cite: 82].
Bei flachen Startplätzen und sehr wenig Wind besteht die Gefahr, dass der Passagier sich ebenfalls zu früh in das Gurtzeug setzt[cite: 85]. Deshalb macht es Sinn, den Passagier während des Laufens immer wieder anzufeuern[cite: 86].
Wenn der Passagier sich beim Beschleunigen plötzlich ins Gurtzeug setzt, wird die Kappe nach vorne schießen, und der Pilot muss diese Bewegung durch beidseitiges Bremsen abfangen[cite: 87]. Sollte dies mit einem schweren Passagier in flachem Startgelände bei einer geringen Laufgeschwindigkeit passieren, so ist ein Startabbruch empfehlenswert[cite: 88]. Ist der Passagier jedoch leicht und das Startgelände steil, so kann man bei hoher Laufgeschwindigkeit gegebenenfalls trotzdem den Start durchführen, selbst wenn der Passagier sich schon in das Gurtzeug gesetzt haben sollte[cite: 89, 90].
6.4. Starttechniken bei unterschiedlichen Windbedingungen
Bei stärkerem Wind sollte man die Trimmer des Tandems öffnen und das rückwärts Aufziehen bevorzugen[cite: 92]. Das rückwärts Aufziehen hat sogar schon bei mäßigem Wind Vorteile, weil die Kappe dadurch sehr gründlich kontrolliert werden kann[cite: 93]. Außerdem kann man dem asymmetrischen Hochsteigen der Kappe leichter entgegenwirken[cite: 94]. Der Kontrollblick entfällt und ermöglicht dadurch einen harmonischen Übergang in den Startlauf, mit geringerer Gefahr des zu frühen Hinsetzens des Passagiers[cite: 95]. Gegebenenfalls bietet es sich an, die äußersten A-Leinen etwas einzuholen und somit mit angelegten Ohren aufzuziehen, um die Energie im System zu verringern[cite: 96]. In diesem Fall sollte man den Passagier unbedingt darauf hinweisen, dass man der hochsteigenden Kappe gegebenenfalls entgegenlaufen muss (also entgegen der Startrichtung nach oben, zum Schirm hin)[cite: 97]. Deshalb muss der Startplatz auch oberhalb der ausgelegten Schirmkappe hindernisfrei sein[cite: 98].
Bei wenig Wind bietet es sich an, vor dem Aufziehen die A-Leinen leicht durchhängen zu lassen, um das Hochsteigen der Kappe mit einem kleinen Ruck zu unterstützen[cite: 184].
6.5. Startabbruch
Bei einem Startabbruch bremst der Pilot beidseitig durch, verlangsamt den Startlauf bis zum Stillstand und läuft dabei seitlich zusammen mit dem Passagier den Hang ab[cite: 91].
6.6. Passagiergewicht
Ein Passagier, der schwerer ist als der Pilot, sollte nur von einem besonders routinierten Tandempiloten bei optimalen Wind- und Geländebedingungen geflogen werden[cite: 107]. Nimmt man besonders leichte Menschen mit, so ist es besonders wichtig, dass das minimal zulässige Startgewicht des Tandems nicht unterschritten wird[cite: 151]. Der Schirm kann ansonsten instabil werden[cite: 152].
7. Flugmanöver und Flugeigenschaften
7.1. Steuerung und Flugeigenschaften von Tandemschirmen
In keinem Fall darf ein Tandempilot dem Passagier die Steuerleinen überlassen[cite: 20]. Die Trimm-Geschwindigkeit ist bei einem Tandemschirm meist höher als die Geschwindigkeit des besten Gleitens[cite: 99]. Fliegt man einen Tandem im mittleren Gewichtsbereich, ist die Flächenbelastung circa 30% höher als bei einem einsitzigen Gleitschirm[cite: 100]. Da ein Tandem über längere Leinen verfügt, ist der Kurvenradius von Pilot und Passagier größer und lässt damit die Geschwindigkeit und das Kurvengewicht (G-Kräfte) höher steigen als bei einem Soloschirm (bei gleicher Sinkgeschwindigkeit)[cite: 101].
Die Passagiere können den Kurvenflug dadurch unterstützen, dass sie ihr Körpergewicht zur Kurveninnenseite verlagern[cite: 191]. Das hilft dem Piloten immens und nimmt Steuerdruck aus dem System, denn dieser ist bei Tandemschirmen ohnehin deutlich höher[cite: 192]. Zudem sind Tandems träger und müssen mit einem größeren Radius als Solos geflogen werden[cite: 193]. Sie reagieren durch das höhere Gesamtgewicht und die längeren Leinen auch weniger auf Gewichtsverlagerung[cite: 194].
Eine enge, steile Kurve mit geringem Radius wird aus der Geschwindigkeit des geringsten Sinkens durch Gewichtsverlagerung zur Kurveninnenseite eingeleitet, indem man die Außenbremse zunächst freigibt und dann die Innenbremse nachzieht[cite: 195].
7.2. Kommunikation während des Fluges
Auch während des Fluges sollte regelmäßig mit dem Passagier gesprochen werden, damit der Pilot aufkommendes Unwohlsein rechtzeitig erkennen kann[cite: 121].
7.3. Abstiegshilfen
7.3.1. Anlegen der Ohren
Manchmal fliegen Piloten auch mit sogenannten angelegten Ohren; dabei werden die Außenseiten des Schirms durch die äußersten Leinen herabgezogen[cite: 160]. Dies sorgt für eine höhere Flächenbelastung und damit höhere Sinkwerte bei gleichzeitig sehr stabilem Flugverhalten[cite: 161]. Allerdings erhöht sich damit auch die zu fliegende Abrissgeschwindigkeit, um einen Strömungsabriss zu verhindern[cite: 162]. Deshalb sollte man die Trimmer zusätzlich öffnen und dadurch schneller fliegen[cite: 163]. Sollten die Ohren nach Freigabe der Außenleinen sich nicht selbstständig wieder öffnen, so darf man die Bremsen nur bis zum mittleren Steuerleinenbereich einseitig oder beidseitig „anbremsen“, um sie wieder zu öffnen[cite: 164]. Das Ohrenanlegen gilt als die sicherste und für Passagiere am wenigsten belastende Abstiegshilfe[cite: 165].
7.3.2. B-Stall
Um noch mehr Höhe abzubauen, kann der Pilot auch einen sogenannten B-Stall ausführen[cite: 166]. Bei diesem zieht man die B-Galerie der Leinen zügig nach unten, sodass der Schirm in der Mitte zusammengezogen wird und eine kleinere Fläche bildet[cite: 167]. Dadurch sinkt der Schirm mit über 4 m/s[cite: 168]. Der B-Stall muss mäßig schnell eingeleitet und zügig ausgeleitet werden, damit sich der Schirm öffnen kann, bevor er in den Sackflug übergehen würde[cite: 169].
7.4. Störungen und deren Behebung
7.4.1. Sackflug
Einen Sackflug kann man auch bewusst provozieren, indem man die B-Gurte in der gezogenen Position loslässt, die Bremsen aber unten gehalten werden[cite: 170]. Oder auch wenn die B-Gurte zu langsam freigegeben werden[cite: 171]. Außerdem, wenn der Schirm beim Vornicken aus dem B-Stall angebremst wird[cite: 171].
7.4.2. Frontklapper
Bei einem symmetrischen Frontklapper sollte der Pilot beide Bremsen beim Wiederöffnen kurz betätigen und das Anfahren des Schirms dadurch ermöglichen, dass er beide Bremsen wieder nach oben führt, um das erneute Anliegen der Strömung zu ermöglichen[cite: 178].
7.4.3. Seitliche Einklapper
Bei seitlichen Einklappern sollte man auf der offenen Seite gegenbremsen, um ein Abtauchen der Kappe und damit einen Spiralsturz zu verhindern[cite: 179].
7.4.4. Trudeln
Kreist man extrem langsam und zieht dabei möglicherweise noch abrupt die Innenbremse noch stärker, so kann es sein, dass man ins Trudeln gerät und sich Pilot und Passagier eintwisten (also unterhalb des Schirmes verdrehen)[cite: 180]. Das wäre gefährlich[cite: 181]. Deshalb muss das Trudeln vorher durch Freigeben der kurveninneren Bremse verhindert werden, sodass der Schirm wieder Geschwindigkeit aufnehmen kann[cite: 181, 182].
8. Landung
8.1. Landeanflug
Mit einem Tandem wird man den gesamten Landeanflug deutlich großräumiger fliegen[cite: 185]. Den Passagier weist man erst beim Anfliegen der Position über sein Verhalten beim Landeanflug und Landung ein[cite: 186]. Um Pendeln und verstärktes Sinken zu vermeiden, sollte der Pilot mit geringer Schräglage die Kurven in den Quer- und Endanflug einleiten[cite: 187]. Letzterer soll eher lang ausfallen, sodass der Passagier sich gut an die Anweisungen des Piloten halten kann[cite: 188]. Die aufrechte und laufbereite Landehaltung, beziehungsweise die ausgestreckten Beine für eine Landung im Sitzen, sollten jeweils im Queranflug oder spätestens zu Beginn des Endanfluges eingenommen werden[cite: 189].
8.2. Landepositionen und -techniken
Wenn Pilot und Passagier im Landeanflug die Landung in der Position nebeneinander durchführen, haben beide ungestörte Sicht nach vorne, der Pilot gute Kontrolle über den Passagier und wenig Behinderung beim Laufen nach dem Aufsetzen[cite: 13]. Es können dann beide nebeneinander laufen und verhindern so, übereinander zu stolpern[cite: 14]. Allerdings wird heutzutage auch deswegen meistens im Sitzen gelandet, weil sich dann beide beim Laufen nicht verletzen können[cite: 15]. Außerdem kann man dann mit höherer Geschwindigkeit landen, was die Sicherheit weiter erhöht, denn der Schirm bleibt dabei stabiler[cite: 16]. Entscheidet sich der Pilot für eine Landung nebeneinander stehend, so muss er darauf achten, dass sich der Rettungsgerätegriff nicht in Reichweite des Passagiers befindet und die Sitzposition zur Landung frühzeitig eingenommen wird[cite: 17]. Am besten bereits im Gegenanflug, sodass er sich auf der Innenseite der zur Landeteilung geflogenen Kurve befindet, damit er stets freie Sicht auf den Aufsetzpunkt hat[cite: 18].
8.3. Aufsetzen
Um ein möglichst weiches Aufsetzen mit geringer Lande- und Sinkgeschwindigkeit zu erreichen, sollte der Pilot die Trimmgeschwindigkeit mit deutlichem Anbremsen abfangen und dadurch ein bodenparalleles Ausgleiten ermöglichen[cite: 190]. Anschließend folgt entschlossenes Durchbremsen, unmittelbar vor dem Aufsetzen[cite: 191].
Bei Starkwind sollte nach dem Aufsetzen nicht stark angebremst werden, weil ansonsten der Schirm Passagier und Piloten nach hinten ziehen würde[cite: 12].
9. Notfälle und Unfallmanagement
9.1. Rettungsschirmauslösung
Sollte ein Tandem-Pilot gezwungen sein, den Rettungsschirm auszulösen, so muss er diese Entscheidung früher treffen als bei einem Soloflug[cite: 172]. Grund dafür ist das höhere Gewicht und die größere Fläche, weshalb der Rettungsschirm später öffnet[cite: 173]. Zudem sind die einwirkenden Kräfte höher und ein möglicherweise dadurch entstehender Spiralsturz könnte zur Handlungsunfähigkeit des Piloten führen (Blackout wegen hoher G-Kräfte)[cite: 174]. Aber auch aus Verantwortungsbewusstsein dem Passagier gegenüber sollte man so eine Entscheidung lieber zu früh als zu spät treffen[cite: 175]. Die Flächenbelastung einer Doppelsitzer-Reserve hat bei doppelter Fläche eine ähnliche Flächenbelastung wie die Rettung eines Soloschirmes[cite: 176]. Nach der Auslösung der Rettung hängen beide in etwa gleicher Position wie im Flug unter dem Rettungsschirm[cite: 177].
9.2. Unfallmeldung
Sowohl in Deutschland als auch in Österreich sind Piloten nach einem Unfall verpflichtet, diesen an den DHV beziehungsweise an die ACG zu melden[cite: 24]. Tun sie das nicht, so ist dies eine Ordnungswidrigkeit beziehungsweise Verwaltungsübertretung gemäß der §§ 7 LuftVO beziehungsweise in Österreich nach § 136 LFG[cite: 25].
